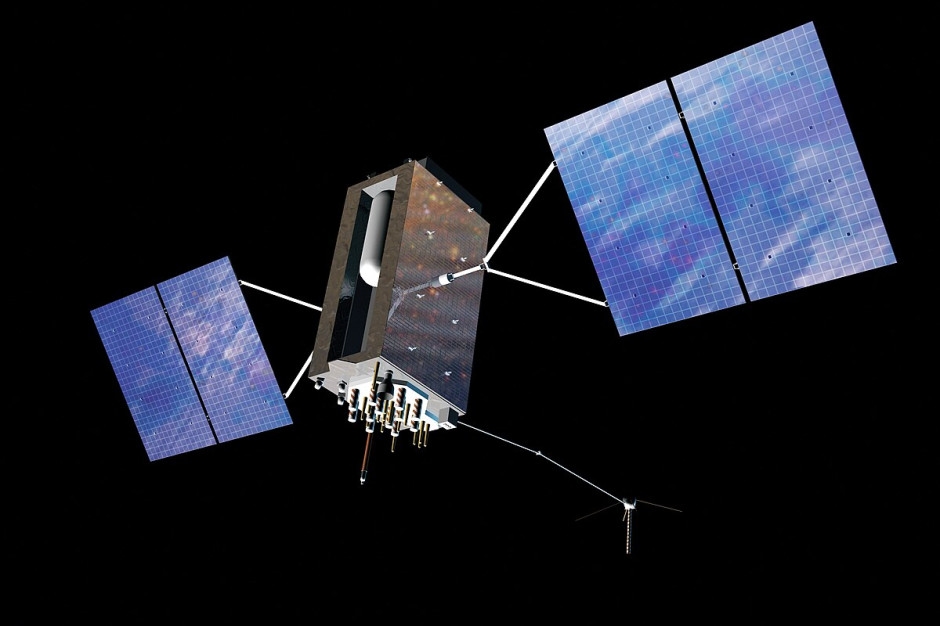Psychische Gesundheit von Rettungssanitätern: „Empathie beginnt bei sich selbst“

Rettungssanitäter sind oft die Ersten, die Leben retten, erhalten aber als Letzte Unterstützung. Sie kämpfen mit Traumata, aggressivem Verhalten von Patienten und dem Mangel an systemischen Lösungen zum Schutz ihrer psychischen Gesundheit. Dennoch sprechen sie zunehmend offen über ihren Hilfebedarf – auch für sich selbst. Laut Dr. A. Krasowska fehlt es in medizinischen Ausbildungsprogrammen an emotionaler Kompetenz. Diese Probleme wurden während der 10. Nationalen Wissenschafts- und Ausbildungskonferenz mit dem Titel „Psychologische Unterstützung im Rettungsdienst“ erörtert.
„Lasst uns gemeinsam auf unsere psychische Gesundheit achten – denn sie ist unglaublich wichtig“, appellierte Marcin Podgórski , Direktor des Polnischen Medizinischen Luftrettungsdienstes , zur Eröffnung der Konferenz. Er betonte, dass die psychische Sicherheit des medizinischen Personals genauso ernst genommen werden müsse wie die Sicherheit der Patienten. In einem Interview mit politykazdrowia.com sagte der Direktor des LPR :
LPR bietet seinen Mitarbeitern seit 15 Jahren ein psychologisches Unterstützungsprogramm an. Jeder kann anonym Hilfe in Anspruch nehmen. Ich stelle fest, dass die jüngere Generation der Rettungskräfte diese Unterstützung als Standard im System erwartet.
In einem Interview mit politykazdrowia.com erinnerte der Direktor der LPR daran, dass das Gesetz über den staatlichen Rettungsdienst einen wichtigen ersten Schritt darstellte: die Verpflichtung der Woiwoden, für angemessene organisatorische Bedingungen zu sorgen und Psychologen zur Unterstützung der medizinischen Disponenten in den einzelnen Leitstellen einzustellen . Diese Bestimmung wurde umgesetzt und wird derzeit in der Praxis angewendet.
Siehe auch:Auf der Konferenz wies Podgórski darauf hin, dass in Polen die Vorstellung, Rettungssanitäter müssten „hart sein“, weiterhin verbreitet sei. Gleichzeitig führten chronischer Stress, die Konfrontation mit dem Tod und aggressive Patienten zu zunehmenden psychischen Problemen unter den Rettungssanitätern.
Die Anwältin und Rettungssanitäterin Judyta Moskała erinnerte daran, dass der Rechtsschutz für medizinisches Personal kein Privileg, sondern eine Verpflichtung des Staates sei.
Das Leben eines Rettungssanitäters ist genauso viel wert wie das Leben eines Patienten. Das Gesetz verlangt keinen Heldenmut – wir sind nicht verpflichtet, uns selbst zu opfern, um andere zu retten. Das Strafgesetzbuch schützt uns vor Aggression und Behinderung medizinischer Maßnahmen.
Wie sie hinzufügte:
Wir haben auch das Recht, bei Verletzungen unserer Persönlichkeitsrechte Schadensersatz zu fordern. Es ist wichtig, die entsprechenden Bestimmungen zu kennen, um zu verstehen, dass die Verteidigung der eigenen Sicherheit kein Zeichen von Schwäche, sondern ein gesetzlich verankertes Recht ist.
Moskała betonte außerdem, dass Solidarität und Freundlichkeit unter den Rettern notwendig seien:
Wir sollten keine Angst davor haben, Fehler einzugestehen oder um Unterstützung zu bitten. Gegenseitiger Respekt ist der erste Schritt zu psychischer Gesundheit.
Erinnern wir uns daran, dass der Sejm derzeit einen Regierungsentwurf zur Änderung des Strafgesetzbuches, des Gesetzes über geringfügige Straftaten und des Verfahrensgesetzes für geringfügige Straftaten bearbeitet, der härtere Strafen für Angriffe auf Amtsträger und Helfer vorsieht.
Nach den vorgeschlagenen Regelungen wird ein Angriff auf einen Polizeibeamten, Feuerwehrmann, Rettungssanitäter oder einen Helfer bei der Rettung anderer mit einer Freiheitsstrafe zwischen drei Monaten und fünf Jahren geahndet. Bisher betrug die Höchststrafe drei Jahre, für Zivilpersonen zwei Jahre.
Siehe auch:Der Soziologe, Psychotherapeut und Schriftsteller Jarosław Gibas stellte fest, dass Aggressionen gegen medizinisches Personal ein weltweites Phänomen sind, das in der Forschung gut dokumentiert ist. Er sagte:
In Polen fehlen systematische Statistiken, doch die Daten aus anderen Ländern sind alarmierend. In den Niederlanden erleben 60 % der Pflegekräfte psychische Gewalt , und in den USA berichten bis zu 70 % der Mitarbeiter in Notaufnahmen, Opfer verbaler oder körperlicher Übergriffe geworden zu sein. In Australien wird in großen städtischen Krankenhäusern durchschnittlich täglich ein schwerwiegender Vorfall von Aggression gemeldet.
Gibas wies darauf hin, dass die Ursache der Gewalt nicht im bösen Willen des Patienten liegt, sondern in neurobiologischen und emotionalen Mechanismen:
Stress aktiviert die Amygdala, das Zentrum, das für die Kampf-oder-Flucht-Reaktion zuständig ist . Dies führt dazu, dass der Frontallappen, der für logisches Denken verantwortlich ist, inaktiv wird. In einer Paniksituation eine rationale Reaktion zu erwarten, ist daher ein systematischer Fehler.
Laut Gibas kann ein Rettungssanitäter, der diese Prozesse versteht, Spannungen in der Interaktion mit dem Patienten effektiver abbauen:
Man kann Feuer nicht mit Feuer löschen . Aggressionen lassen sich nur durch Aufklärung, Beruhigung und das Vermitteln eines Gefühls der Sicherheit abbauen. Emotionale Kompetenz sollte daher ein obligatorischer Bestandteil der medizinischen Ausbildung sein.
Der Experte erinnerte auch daran, dass Gewalt gegen medizinisches Personal nicht nur eine individuelle, sondern auch eine systemische Dimension hat.
Auch wenn ein Arbeitgeber nicht reagiert, Beschwerden ignoriert oder verbale Aggressionen duldet, stellt dies eine Form von Gewalt dar. Ein System, das seine Angestellten nicht emotional schützt, wird selbst zum Aggressor.
Die Psychologin und Rettungssanitäterin Katarzyna Bartyńska betonte, dass die Grenze zwischen Berufs- und Privatleben im Arbeitsalltag eines Rettungssanitäters oft verschwimmt:
Der Patient kehrt in Form von Erinnerungen, Bildern und Geräuschen zu uns zurück. Manchmal genügt schon ein Geruch, um eine Erinnerung auszulösen. Viele Rettungssanitäter leben in einem Zustand ständiger Anspannung.
Sie fügte hinzu, dass eine langfristige Konfrontation mit Traumata zu Angststörungen und Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) führen kann, von denen schätzungsweise bis zu 6-8 Prozent der Rettungskräfte in Polen betroffen sind.
Deshalb sind Rituale zum Dienstende – Gespräche, Nachbesprechungen und Besprechungen – so wichtig. Sie helfen uns, die Erfahrung abzuschließen und in den Alltag zurückzukehren.
Die Psychiaterin Dr. Aleksandra Krasowska, Ärztin, Doktorin der medizinischen Wissenschaften und Fachärztin für Psychiatrie mit Schwerpunkt Sexualmedizin, wies darauf hin, dass Empathie keine angeborene Gabe, sondern eine erlernbare Fähigkeit sei:
Empathische Intervention sollte als medizinische Maßnahme betrachtet werden. Sie ist kein Luxus, sondern ein Bestandteil einer wirksamen Behandlung. Gleichzeitig mangelt es in der medizinischen Ausbildung an emotionaler Kompetenz.
Experten waren sich einig, dass die psychische Gesundheit von Rettungssanitätern ein Problem der öffentlichen Sicherheit darstellt. Marcin Podgórski von der LPR formulierte es so:
Heutzutage setzt sich immer mehr die Auffassung durch, dass psychische Hygiene genauso wichtig ist wie körperliche Hygiene.
Wie auf der Konferenz betont wurde, muss das Gesundheitssystem sich nicht nur um die Patienten kümmern, sondern auch um diejenigen, die jeden Tag Leben retten.
Aktualisiert: 07.11.2025 17:30
politykazdrowotna